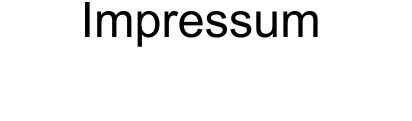Noch nie hatte George Lomont solch grauenhafte Angst verspürt. Das Entsetzen hatte seine Krallen nach ihm ausgestreckt und ließ ihn nicht mehr los. Mit weit aufgerissenem Mund schnappte Lomont nach Atem. Die feuchtkalte Nachtluft stach in seiner Lunge wie tausende glühender Nadeln Ein schmerzliches Ächzen entrang sich seinen blutleeren Lippen. George Lomont rannte um sein Leben!
Sie jagten ihn seit einer halben Stunde durch den gespenstischen Wald, in dem man kaum die Hand vor den Augen sah. Der Mond war aufgegangen, aber die bleiche Sichel verschwand immer wieder hinter drohend aufgetürmten Wolken. Wenn sich das kalte Licht auf die schweigende Erde ergoß, verwandelte es jeden Baum in ein Ungeheuer, jeden Strauch in einen zusammengesunkenen Körper, jeden Stein in einen aufgesperrten Rachen, der bereit war, den Fliehenden zu verschlingen.
George Lomont glaubte, irrsinnig zu werden.
Sie jagten ihn gnadenlos. Sie kannten kein Mitleid. Wer immer sie auch waren, sie mußten die gräßlichsten Wesen sein, die es auf dieser verzweifelten Welt gab.
Lomont stolperte, stürzte, fiel mit dem Gesicht in den weichen, morastigen Boden. Blut strömte aus seiner Nase, lief über seinen Mund. Süßlicher Geschmack breitete sich auf seiner Zunge aus.
Lomont war am Ende. Er konnte nicht mehr weiter.
Doch dann waren sie wieder da, sie, seine Folterknechte. Sie stachen ihn, schnitten tief in sein Fleisch, versengten seine Haut mit glühenden Eisen.
Seit einer halben Stunde trieben sie den gepeinigten Menschen auf diese grausame Weise vor sich her, in einer ganz bestimmten Richtung. Und was beinahe das schrecklichste an der Tortur war: George Lomont konnte seine Verfolger nicht sehen. Sie waren unsichtbar. »Gnade!« winselte der auf dem Boden liegende Mann. »Erbarmen!«
|